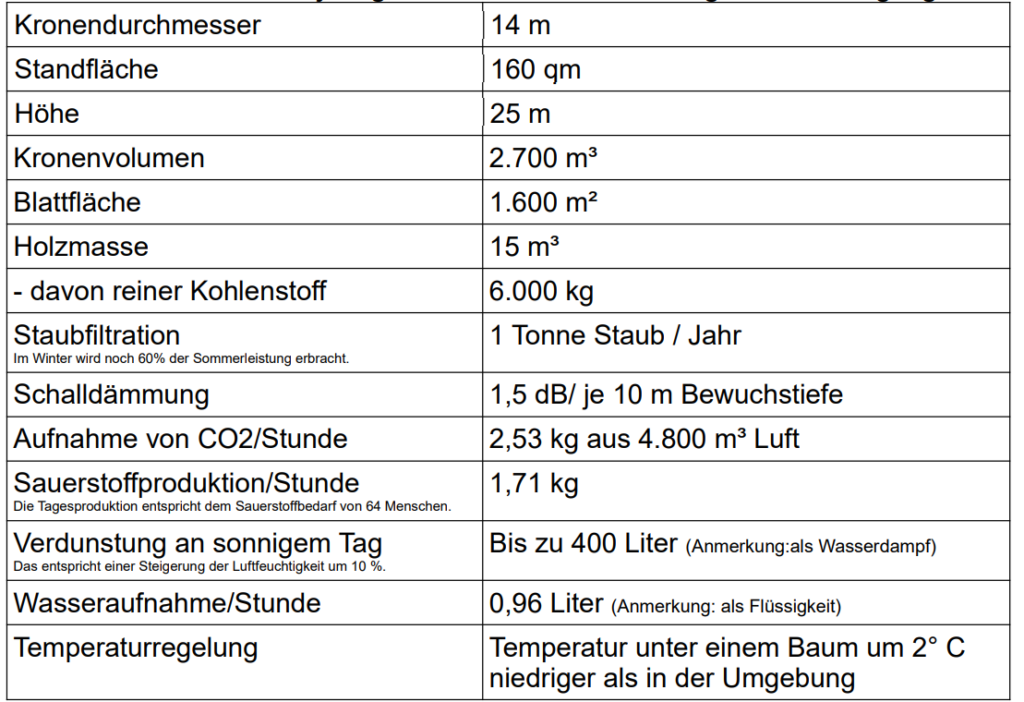Das Thema Pflege geht jeden an, ob man will oder nicht. Das betrifft nicht nur die Pflichtbeiträge für die Pflegeversicherung. Irgendwann wird man vielleicht selbst Pflegefall oder man muss die Versorgung bzw. die Unterbringung von Angehörigen organisieren. Spätestes dann stellen sich jede Menge Fragen.
Die aktuelle Situation der Pflegeheime und der ambulanten Pflegedienste in München wurde am vergangenen Donnerstag im Sozialausschuss vorgestellt. Wer sich ein vollständiges Bild verschaffen möchte, sollte die 42 bzw. 18 Seiten lesen, die das Sozialreferat jedes Jahr mit großem Aufwand zusammenstellt und die jede Menge Informationen enthalten. Im Folgenden können daraus nur auszugsweise ein paar Zahlen sowie Erkenntnisse aus der Diskussion im Ausschuss berichtet werden, die mir besonders wichtig erscheinen.
„Pflege in München – eine Übersicht“ weiterlesen