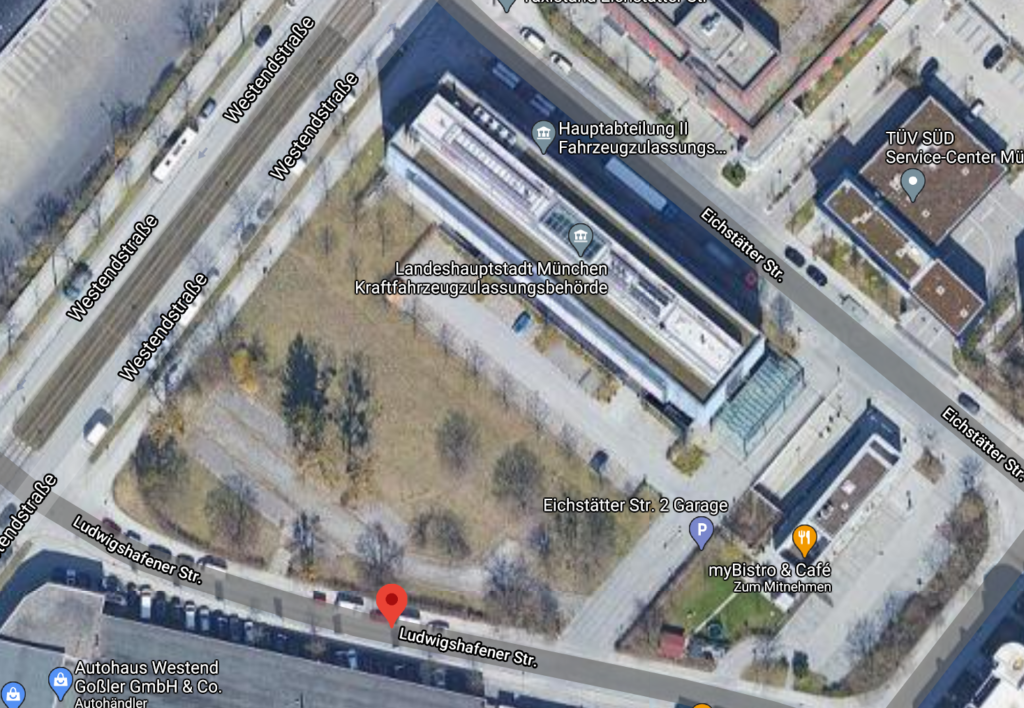Die heutige Sitzung des Ausschusses für Stadtplanung und Bauordnung hat es deutlich gezeigt: Die neue grün-rote Mehrheit im Stadtrat will nicht nur die Verkehrswende, sondern auch neue Wege im Wohnungsbau gehen. Und das ab sofort.
Was war zu entscheiden? Zwei Vorlagen der Verwaltung zur künftigen Wohnbebauung auf dem Viehofgelände (im Schlachthofviertel) bzw. im sogenannten Kreativquartier an der Schwere-Reiter-Straße standen zur Beratung an. Die Einzelheiten der jeweiligen Pläne finden sich hier bzw. hier. Von übergeordneter Bedeutung sind jedoch nicht die Details der beiden Vorlagen, sondern die Änderungen, die in den ergangenen Beschlüssen von der neuen Stadtratsmehrheit durchgesetzt worden sind.
Danach wird die Stadt keine Grundstücke mehr an private Baugemeinschaften im Rahmen des bisherigen München-Modell-Eigentum verkaufen. Die städtische Förderung von privatem Wohneigentum wird in München ab sofort eingestellt, selbst dann, wenn es wie in den beiden Vorlagen nur um kleine Flächenanteile geht, nämlich gerade einmal 10% der zu bebauenden Grundstücke. Stattdessen sollen Baugenossenschaften o.ä. ein Erbbaurecht daran erwerben können. Die Stadt bleibt damit weiterhin Eigentümer und kann nach Ablauf des Erbbaurechts (z.B. nach 30, 60 oder 80 Jahren) neu über die Nutzung ihrer Grundstücke entscheiden.
Im Ausschuss hat dies zu einer intensiven Diskussion geführt. CSU und FDP haben die bisherige Förderung des privaten Wohneigentums zäh verteidigt. Ihr zentrales Argument ist, dass von der bisherigen Förderpraxis nicht irgendwelche kommerziellen Bauunternehmer profitieren, sondern Münchnern mit einer selbst genutzten Immobilie zu einem wichtigen Baustein für ihre private Altersvorsorge geholfen wird. Außerdem würden ansonsten Familien, die Wohneigentum erwerben wollten, gezwungen, aus München wegzuziehen.
Diese Argumente klingen gut, verkennen aber mehrere Punkte, die in der weiteren Diskussion von Stadträten der SPD und der Grünen eingewandt wurden:
– Die Preise für privates Wohneigentum sind in München inzwischen in solche Höhen gestiegen, dass selbst mit einer Förderung nach dem bisherigen Modell breite Bevölkerungsschichten kein Wohneigentum erwerben können. Schon gar nicht können dies einkommensschwächere Gruppen, die von der Wohnungsnot in München besonders betroffen sind.
– Die Differenz zwischen den Marktpreisen für die fraglichen Grundstücke und den nach dem bisherigen Modell zu zahlenden Preisen sind so groß geworden, dass eine Förderzusage quasi einem „Lottogewinn“ entspricht. Eine Rechtfertigung, warum Einzelpersonen oder auch Baugemeinschaften eine so große Förderung (durch den enormen Preisnachlass auf den Grundstückspreis) erhalten sollten, ist nicht erkennbar.
– Und schließlich gibt es ja weiterhin einen großen privaten Wohnungsmarkt in München, sowohl im Bestand als auch im Neubaubereich. Gegenwärtig entstehen nur etwa 2000 von 10000 neuen Wohnungen auf städtischen Grundstücken. Bei den anderen 8000 sollte für den ein oder anderen FDP Wähler etwas zur Altersvorsorge dabei sein.
Aus meiner Sicht spricht noch etwas anderes gegen jeglichen Verkauf von Gründstücken der Stadt an private Eigentümer (-Gemeinschaften). Dazu muss ich etwas länger ausholen:
In einer hochattraktiven Stadt wie München ist es schlicht unmöglich, die Gesetze des Marktes im Bereich Wohnen außer Kraft zu setzen. Der Wunsch in dieser Stadt zu arbeiten und zu leben ist ungebrochen. Von einer Stadtverwaltung zu erwarten, dass sie für breite Schichten der Bevölkerung günstigen Wohnraum bereitstellen kann, entweder zur Miete oder sogar als Eigentum, verkennt die Möglichkeiten staatlichen Handelns. Es ist und bleibt einer der wenigen – vielleicht der einzige – Nachteil, wenn man in München lebt, dass Wohnraum hier viel teurer ist als in anderen Städten Bayerns oder Deutschlands. Das ist im Übrigen in Paris, London und New York ganz genauso. München ist zwar (noch) nicht so groß wie diese Weltstädte aber mindestens so attraktiv, wenn man einschlägigen Rankings glauben darf.
Wohnungspolitik muss sich daher darauf konzentrieren, diejenigen zu unterstützen, für die der teure Wohnraum nicht nur unangenehm ist, sondern existenzgefährdend. Es ist etwas anderes, ob die teure Wohnung in München dazu führt, dass man auf andere Annehmlichkeiten, beispielsweise ein Auto oder teure Reisen, verzichten muss, oder ob man mit einem niedrigen Einkommen überhaupt nicht mehr in dieser Stadt wohnen kann. Und genau an dieser Stelle kann und muss die Stadt eingreifen. Andernfalls wird die alleinerziehende Krankenschwester oder der Polizist mit seiner Familie aus München verdrängt. Das kann niemand wollen.
Dazu braucht es aber jeden Quadratmeter Wohnraum, auf dessen Mietpreis die Stadt langfristig (!) Einfluss nehmen kann. Eine zeitlich begrenzte Sozialbindung für Wohnungen des privaten Wohnungsbaus, die nach wenigen Jahren ausläuft, kann das Problem nicht lösen. Im Gegenteil, es braucht Wohnungen, über deren Mietpreise die Stadt dauerhaft eine gewisse Kontrolle behält. Und daher erscheint es mir richtig, die wenigen Flächen im Eigentum der Stadt, die nicht sofort von den städtischen Baugesellschaften entwickelt werden können, mit dem Erbbaurecht langfristig für zukünftige Gestaltungsmöglichkeiten zu sichern.
Wie dieses Instrument genau anzuwenden ist, wird sich herausstellen müssen. In der Diskussion im Planungsausschuss und in der vorausgehenden Sitzung des Kommunalausschusses klang bereits an, dass die vertragliche Ausgestaltung des Erbbaurechtes viele Fragen aufwirft, angefangen von dem Wunsch nach überschaubaren und einfachen Regelungen bis hin zu der notwendigen Komplexität, um den Besonderheiten des Einzelfalls Rechnung zu tragen. Hier wird die Verwaltung in Zukunft weitere Vorschläge unterbreiten auch unter Berücksichtigung von Erfahrungen aus anderen Städten in Deutschland, die bereits länger das Erbbaurecht bei der Vergabe ihrer Grundstücke für den Wohnungsbau anwenden.
Und die Verkehrswende ? Auch die war Gegenstand der Diskussion im Planungsausschuss. Aber das wird in einem weiteren Beitrag berichtet.