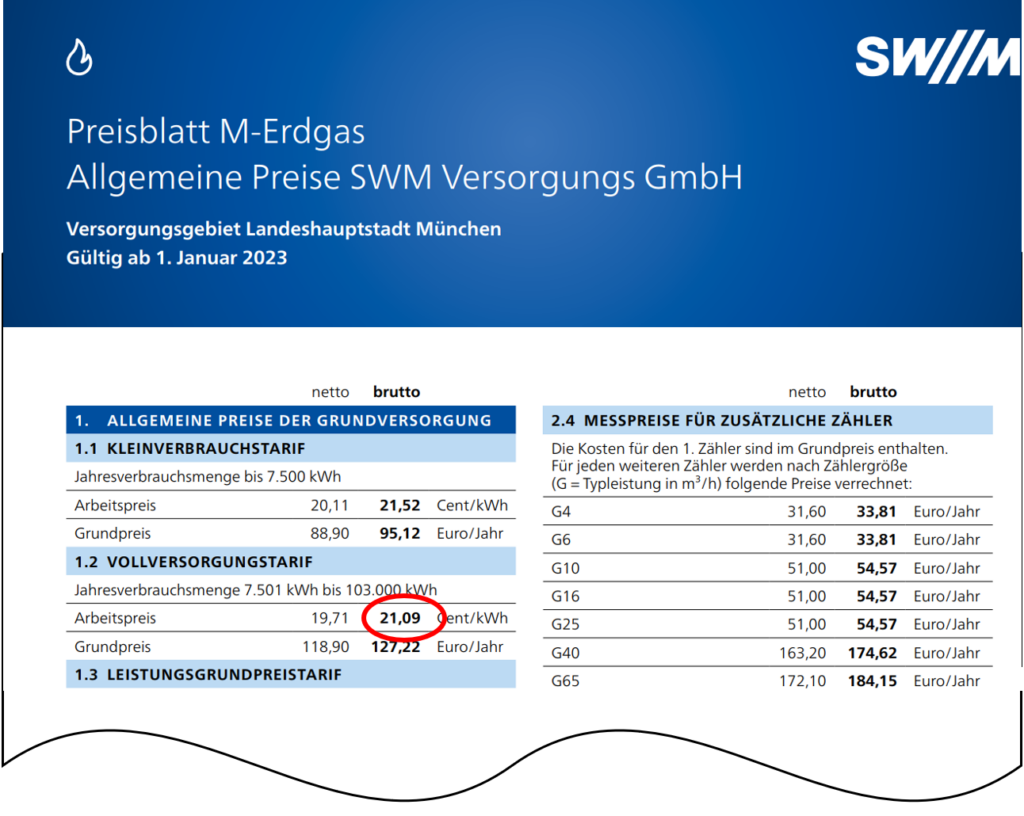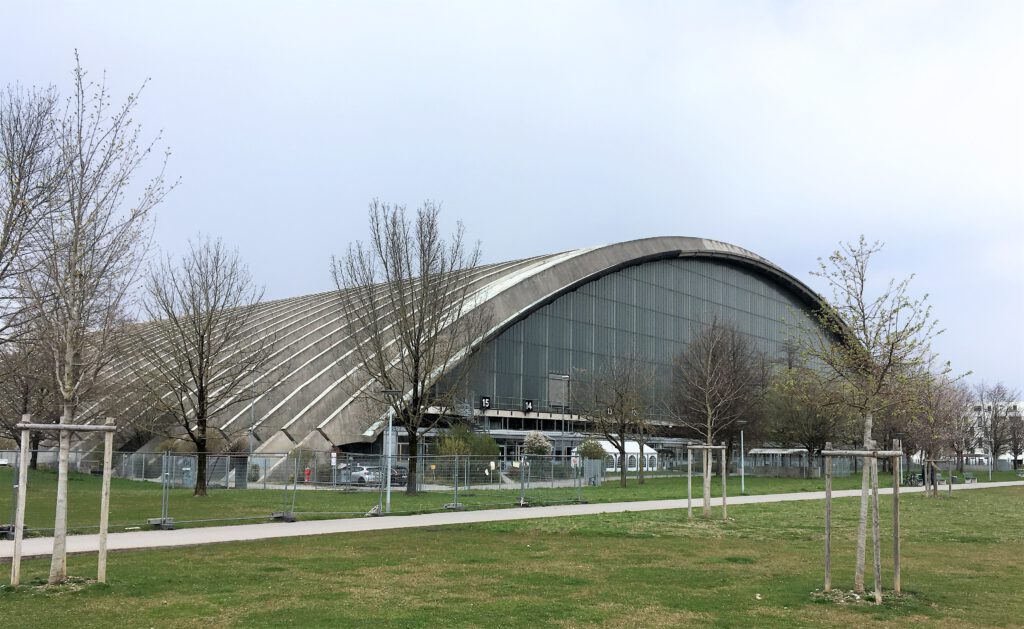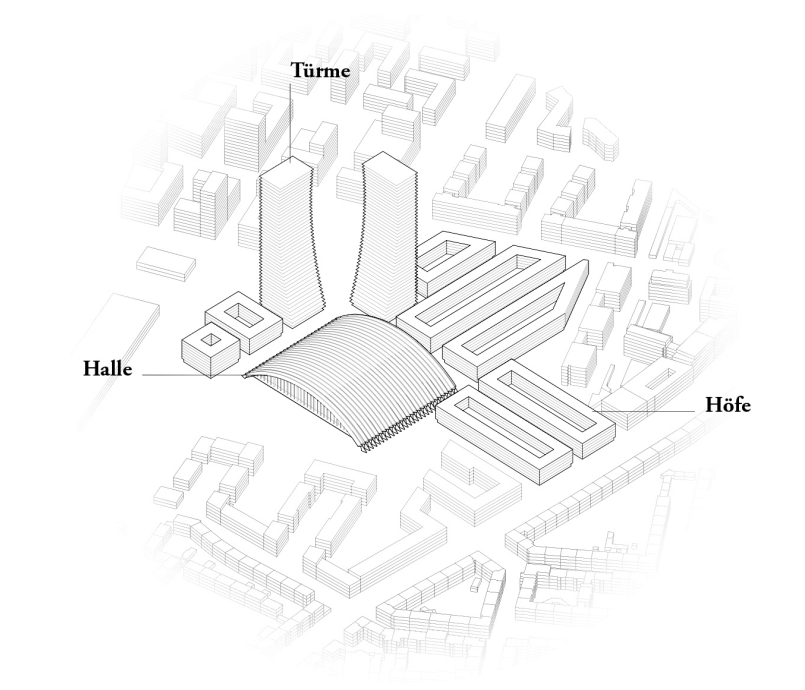Immer wenn eine Kommunal-, Landtags- oder Bundestagswahl ansteht, verändert sich das Münchner Stadtbild. Plakate der Parteien werden an allen nur erdenklichen Stellen aufgestellt, um die Aufmerksamkeit auf Kandidaten und politische Aussagen zu lenken. Nach der Wahl dauert es dann viele Wochen, bis alles wieder abgebaut ist und auch der letzte Ständer beseitigt ist.
Braucht es das wirklich? Und in welchem Ausmaß? Gleich drei Bürgerversammlungen in Nymphenburg, Schwanthalerhöhe und Schwabing haben in den letzten Monaten beantragt, das Plakatieren der Parteien zu beschränken, unter anderem, um „Müllmengen und eine Verschandelung des Stadtbildes zu vermeiden“ . Daher hat sich der Kreisverwaltungsausschuss des Stadtrates am vergangenen Dienstag damit befasst. Anlass für mich, ein paar Gedanken zu diesem Thema zusammenzustellen.
„Wieviel Wahlplakate verträgt München?“ weiterlesen